Wenn du dich mit Luftfracht beschäftigst, stolperst du zwangsläufig über drei Buchstaben: AWB. Der „Air Waybill“, also der Luftfrachtbrief, ist eines der wichtigsten Dokumente im internationalen Güterverkehr. Ohne ihn hebt kein Flieger ab – und kein Frachtstück wird ausgeliefert. In unserem Mega-Video zum Thema AWB zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie der AWB aufgebaut ist. Hier im Artikel bekommst du die ganze Geschichte dahinter – mit vielen Details, Tipps und Beispielen, die dir auch in der Prüfung nützlich sein werden.
Was der AWB eigentlich ist – und warum er mehr kann als ein einfacher Frachtbrief
Der Air Waybill ist das Pendant zum CMR im Straßenverkehr oder zum B/L in der Seefracht. Doch anders als beim Bill of Lading handelt es sich beim AWB nicht um ein Wertpapier, sondern um ein sogenanntes Sperrpapier – dazu gleich mehr.
Grundsätzlich erfüllt der AWB vier klassische Funktionen:
- Beweisfunktion: Er zeigt, dass zwischen Absender und Luftfrachtführer ein Beförderungsvertrag zustande gekommen ist.
- Übernahmequittung: Die Airline bestätigt, dass sie die Ware erhalten hat.
- Begleitpapier: Der AWB begleitet die Sendung auf dem gesamten Transportweg.
- Ablieferquittung: Er dient als Nachweis, dass die Ware am Zielort korrekt übergeben wurde.
Diese vier Funktionen machen den AWB zu einem unverzichtbaren Dokument, das rechtlich und praktisch alles miteinander verbindet – Absender, Airline, Empfänger und manchmal auch den Spediteur, der zwischen den Parteien vermittelt.

Das Sperrpapier-Prinzip – warum der AWB echte Macht in Papierform ist
Ein zentrales Merkmal des AWB ist seine Eigenschaft als Sperrpapier. Das bedeutet: Nur wer das Originaldokument besitzt, kann nachträglich Anweisungen zur Sendung erteilen. Der AWB wird nämlich in drei Originalen ausgestellt:
- Für die Airline (Frachtführer)
- Für den Empfänger
- Für den Absender
Wenn der Absender beispielsweise nachträglich eine Umladung oder Lieferänderung anweisen möchte, muss er sein eigenes Original vorlegen. Ist es nicht mehr in seinem Besitz, hat er sich selbst „abgesperrt“ – daher der Begriff Sperrpapier. Diese Regelung schützt die Parteien vor Missbrauch und sorgt für klare Zuständigkeiten. Nicht jeder Frachtbrief ist ein Sperrpapier, aber beim AWB gehört dieses Prinzip zum Standard – und das sollte jeder Speditionskaufmann aus dem Effeff wissen.
Vom Frachtbrief zum Multifunktionswerkzeug – wofür du den AWB außerdem brauchst
Der AWB ist weit mehr als nur eine Transportquittung. In der Praxis wird er oft auch verwendet:
- als Zollanmeldung, wenn kein separates Zolldokument erstellt wird,
- als Grundlage der Frachtrechnung,
- und als Informationsquelle für alle Beteiligten im Transportprozess, weil er sämtliche Daten zur Ware enthält – Gewicht, Maße, Verpackungsart, Warenwert, Absender, Empfänger, Flugroute und vieles mehr.
Die Airline muss anhand dieser Informationen genau wissen, wie sie die Ware behandeln darf: ob sie temperaturempfindlich ist, Gefahrgut enthält oder unter bestimmten Sicherheitsauflagen transportiert werden muss. Man könnte sagen: Der AWB ist das „DNA-Profil“ der Luftfracht.
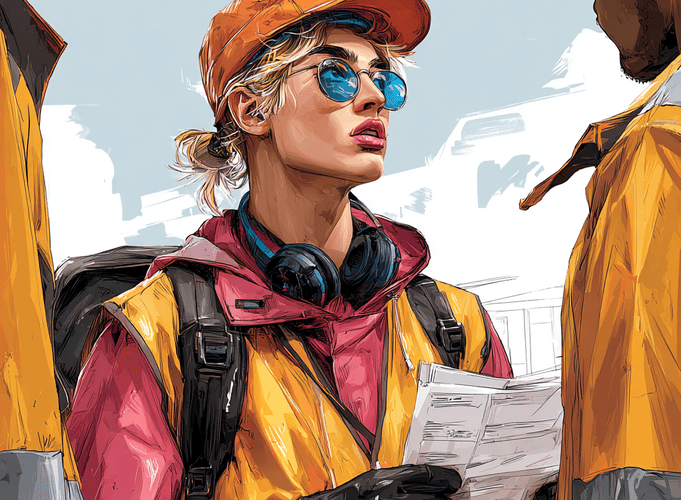
Master, House oder Direct – drei Arten, die du unterscheiden musst
Wenn du Luftfracht bearbeitest oder in der Prüfung vor einem AWB-Ausschnitt sitzt, ist eine der häufigsten Fragen: „Mit welchem AWB-Typ habe ich es hier zu tun?“
Grundsätzlich gibt es:
- Direct AWB: Der Versender ist direkt Vertragspartner der Airline.
- Master AWB (MAWB): Wird vom Versandspediteur ausgestellt, der mehrere Sendungen bündelt.
- House AWB (HAWB): Wird für jede einzelne Teilsendung innerhalb einer Sammelladung ausgestellt.
Das Prinzip lässt sich bildlich so vorstellen:
Mehrere Versender aus der Region Köln–Bonn geben ihre Sendungen bei einem Spediteur ab. Dieser bündelt sie und gibt eine Gesamtsendung an die Airline – mit einem Master AWB. Am Empfangsflughafen übernimmt der Partner-Spediteur die Ware, verteilt sie an die Empfänger, und für jede Einzelsendung gibt es einen House AWB.
Wichtig ist, wer in den jeweiligen Feldern steht:
- Im Master AWB: Shipper = Versandspediteur, Consignee = Empfangsspediteur, Carrier = Airline.
- Im House AWB: Shipper = tatsächlicher Versender, Consignee = tatsächlicher Empfänger, Carrier = Versandspediteur.
- Im Direct AWB: Shipper = Versender, Consignee = Empfänger, Carrier = Airline.
In der Prüfung genügt meist der Blick auf diese drei Felder, um den AWB-Typ eindeutig zu erkennen. Das spart Zeit – und Punkte.
Wenn der Spediteur selbst zum Frachtführer wird
In manchen Fällen ist der Spediteur nicht nur Vermittler, sondern tritt rechtlich selbst als Frachtführer auf. Das passiert, wenn er Sammelladungen betreibt oder als Fixkostenspediteur agiert. Er steht dann im AWB als „Carrier“. Diese Unterscheidung ist juristisch bedeutsam, denn sie legt fest, wer im Schadensfall haftet. Gerade bei Hausfrachten (House AWB) ist das ein Punkt, den du im Berufsalltag nicht übersehen solltest – und in der Prüfung kann eine falsche Zuordnung hier leicht zum Stolperstein werden.
Währungsfeld und Haftungswerte – kleine Felder, große Wirkung
Im Feld 6 steht die Currency, also die Währung, in der der AWB ausgestellt ist. Diese ergibt sich aus den internationalen TACT-Vorschriften (The Air Cargo Tariff). Dort ist festgelegt, welche lokale Währung für welche Strecke gilt. Die Felder 7 bis 10 dagegen haben es in sich – sie betreffen Haftung, Versicherung und Zollwert:
- Feld 8 („Declared Value for Carriage“)
enthält den Wert, den der Kunde gegenüber der Airline deklariert, wenn die Standardhaftung nicht ausreicht. - Feld 9 („Declared Value for Customs“)
steht fast immer auf NCV (No Customs Value), weil der Exporteur den Zollwert im Empfangsland nicht kennen kann. - Feld 10 („Amount of Insurance“)
zeigt, ob der Kunde eine zusätzliche Airline-Versicherung wünscht. Hat er bereits eine eigene Transportversicherung, steht hier NIL oder drei große X, was bedeutet: keine Versicherung über die Airline. - Feld 7 („Weight/Valuation/Other Charges“)
zeigt an, wer welche Kosten trägt – Fracht, Bewertung, Nebenkosten. Hier lässt sich auf einen Blick erkennen, ob etwa der Absender oder Empfänger die Valuation Charge zahlt.
Diese Felder sind klein, aber relevant für die Prüfung Spedition und Logistikdienstleistung – und im Video auf unserem YouTube-Kanal gehen wir sie Feld für Feld gemeinsam durch, damit du sie sicher interpretieren kannst.
Haftung, Versicherung und Missverständnisse in der Praxis
Richtig spannend wird es beim Thema Versicherung. Denn hier passieren in der Praxis und in Prüfungen die meisten Denkfehler. Viele glauben, die Airline hafte automatisch in voller Höhe für den Warenwert – das ist ein gefährlicher Irrtum. Nach den Montrealer Übereinkommen liegt die Haftung der Fluggesellschaft bei rund 22 Sonderziehungsrechten pro Kilogramm (das schwankt leicht, entspricht grob 25–30 € pro Kilo). Wenn deine Ware also 50.000 € wert ist und 300 kg wiegt, ersetzt dir die Airline im Schadensfall höchstens rund 9.000 €. Alles darüber hinaus trägt der Absender selbst – es sei denn, er hat über das Feld 8 („Declared Value for Carriage“) einen höheren Wert angegeben und bezahlt die zusätzliche Valuation Charge.
Hier lauert die typische Verwechslung mit dem Feld 10 („Amount of Insurance“)
– denn das ist keine Haftungserklärung, sondern die Anfrage an die Airline, eine eigene Versicherung zu vermitteln. Wenn dort also ein Betrag steht, ist das kein Haftungsanspruch, sondern eine Versicherungspolice, die gegen Prämie abgeschlossen wird. Wer dagegen „NIL“ oder „XXX“ einträgt, signalisiert: Ich brauche keine Airlineversicherung, weil ich meine eigene Haus-Haus-Transportversicherung habe.
Manchmal kommt es in der Praxis vor, dass ein Kunde in Feld 8 „NVD“ einträgt (No Value Declared), aber im Schadensfall trotzdem den vollen Warenwert ersetzt haben möchte. Das geht natürlich nicht, denn der Eintrag „NVD“ schließt die Haftung über den Standardbetrag hinaus aus. Für Azubis und junge Disponenten ist das eine der wichtigsten Erkenntnisse: Was du in den Feldern 7–10 einträgst, legt später fest, wer im Schadenfall zahlt. Im Video siehst du dazu übrigens ein praktisches Beispiel mit echten Zahlen – das hilft, den Zusammenhang zwischen Wertdeklaration, Haftung und Versicherung endgültig zu durchschauen.
Wie du das frachtpflichtige Gewicht berechnest – und warum 500 kg manchmal günstiger sind als 450
Einer der kniffligsten Punkte bei der Arbeit mit dem AWB ist das Chargeable Weight – das frachtpflichtige Gewicht.
Grundregel: Das höhere Gewicht aus tatsächlichem Gewicht und Volumengewicht ist entscheidend.
Die Formel lautet: Länge × Breite × Höhe (in cm) ÷ 6.000 = Volumengewicht pro Packstück.
Dieses Ergebnis multiplizierst du mit der Packstückanzahl.
Ein Beispiel: Du hast eine Sendung mit einem tatsächlichen Gewicht von 313,4 kg und einem Volumengewicht von 450 kg. Dann gilt zunächst 450 kg als frachtpflichtig.
Allerdings prüfst du zusätzlich, ob es bei der nächsthöheren Gewichtsklasse (z. B. ab 500 kg) eine günstigere Rate gibt. Denn bei den sogenannten Quantity Rates kann das höhere Gewicht manchmal zu einem niedrigeren Preis pro Kilo führen – ein typischer Trick, den gute Disponenten kennen.
Im Chargeable Weight-Feld (Nr. 14) wird also der Wert eingetragen, auf dessen Basis die Luftfrachtkosten berechnet werden. Die eigentliche Rate pro Kilogramm steht im Feld 15 („Rate/Charge“). Diese Logik musst du blind beherrschen, denn sie taucht in fast jeder Prüfungsaufgabe auf.
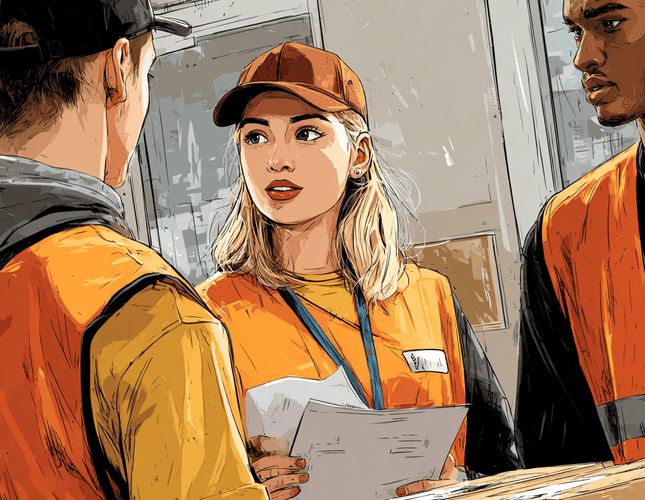
Warum Genauigkeit zählt – und wo Prüflinge häufig stolpern
Beim Ausfüllen des AWB kommt es auf jedes Detail an. Hier ein paar typische Stolperfallen aus der Praxis:
- Rundungsfehler beim Bruttogewicht (immer mit Dezimalstellen, keine glatten Zahlen).
- Verwechslung von Kilogramm und Pfund – in Europa immer K für Kilogramm.
- Leere Felder bei Wertdeklaration oder Versicherung: Es muss immer ein Eintrag stehen, z. B. NVD oder NIL.
- Falsche Reihenfolge bei Sammelladungen: Shipper/Consignee/Carrier sauber prüfen!
Diese kleinen Unachtsamkeiten führen schnell zu Ungereimtheiten oder, schlimmer noch, zu Transportproblemen. Darum ist es sinnvoll, die AWB-Struktur einmal vollständig durchzugehen – genau das tun wir im LOQlearn-Video zum Thema.
Dein AWB-Check: Was du vor jeder Luftfrachtsendung prüfen solltest
Zum Abschluss hier eine kleine Checkliste, die du in der Praxis wie in der Prüfung nutzen kannst:
| Prüffeld | Bedeutung | Worauf du achten musst |
| 1–3 | Absender, Empfänger, Airline | Stimmen die Angaben mit der Sendung überein? |
| 4–5 | Abgangs- und Empfangsflughafen | IATA-Codes prüfen (z. B. FRA, JFK) |
| 6 | Currency | Richtige Währung laut TACT-Tabelle |
| 7–10 | Wertangaben & Versicherung | Immer NVD/NCV/NIL oder Wert einsetzen |
| 11–12 | Stückzahl & Bruttogewicht | Dezimalwerte, kein Runden |
| 14–15 | Chargeable Weight & Rate | Volumengewicht richtig berechnen |
| 17 | Inhaltsbeschreibung | „Consolidated Shipment“ bei Sammelladungen |
Zusammengefasst: Warum der AWB das Rückgrat der Luftfracht ist
- Der Air Waybill ist weit mehr als nur ein Formular. Er ist das rechtliche Rückgrat und das Informationszentrum jeder Luftfrachtsendung. Wer ihn versteht, versteht die Logik der Luftfracht.
- Er zeigt, wie eng kaufmännische Sorgfalt, juristische Verantwortung und praktische Abwicklung miteinander verwoben sind.
- Und genau das macht ihn für angehende Speditionskaufleute so spannend: Der AWB ist kein Papierkram, sondern ein Schlüssel zum Verständnis des gesamten Transportprozesses.
- In unserem AWB-Mega-Video zeigen wir dir die Felder im Detail – aber jetzt weißt du schon, warum jedes davon zählt.

